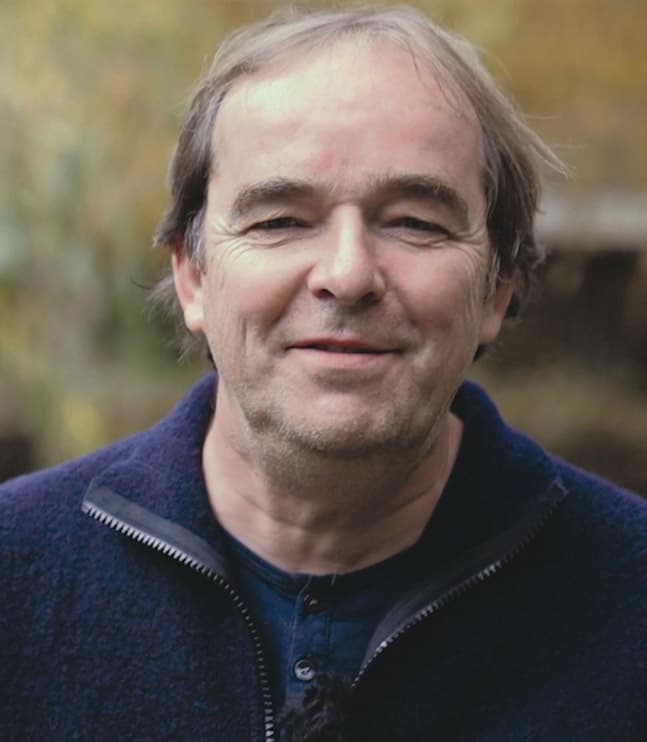Nehmen wir einmal an, Gedankenexperiment, der Wissenschaftsjournalismus würde
einfach aussterben, die Profession gäbe es nicht mehr. Was würden Sie denken,
was passierte dann im öffentlichen Raum, in dem Bereich, den Sie überblicken?
Das fällt mir wirklich schwer vorzustellen, weil ich glaube, dass er nicht aussterben
könnte, weil er einfach notwendig ist. Dann würden die Wissenschaftler das sozusagen
versuchen zu kompensieren und dann würde der Beruf wieder neu entstehen aus der
Wissenschaft heraus, glaube ich. Aber ich versuche mich einmal auf dieses
Gedankenexperiment einzulassen. Ich glaube, wir hätten dann tatsächlich ein
Übersetzungsproblem. Da gäbe es eine Lücke, eine Fallhöhe zwischen dem, was die
Wissenschaft sagt und veröffentlichen möchte und dem, was in der Öffentlichkeit
und auch in der Politik und in der Gesellschaft insgesamt ankommt. Und das birgt
Gefahren, denn dann steht es unverbunden nebeneinander. Und das bedeutet natürlich
immer, dass sich dann diejenigen, die sich dann direkt aus der Wissenschaft
Nachrichten holten, mit denen so ein bisschen tun könnten, was sie wollten. Sie
würden sie vielleicht nicht wirklich in einen Kontext einordnen, sondern
Interpretationsspielräume nutzen. Es könnte auch passieren, dass die Wissenschaftsnachrichten,
die dann kommen, einfach nicht berichtet werden und untergehen. Etwa bestimmte
Fragestellungen, für die man eine Kenntnis haben muss, ein Vorwissen, um sie einordnen
zu können. Da würde ich mir große Sorgen machen, dass da vieles einfach runterfällt.
Ein konkretes Beispiel: Ich glaube, wenn wir Wissenschaftsjournalismus nicht hätten,
dann würden Studien, die im Moment publiziert werden und die z.B. bestimmte Maßnahmen
der Pandemie untersucht haben, also was passiert jetzt in den Restaurants wirklich,
was passiert in den Fitnessstudios oder was passiert mit Kindern in Schulen und in
Kitas. Die würden dann entweder ignoriert, obwohl sie einen wichtigen Datenpunkt
darstellen, oder aber sie würden wiederum überhöht werden in ihrer Geltung. Und
beides ist nicht gut. Es braucht eben diese Balance von jemandem, der weiß, da
werden noch andere Datenpunkte kommen und das zusammenbauen kann, aber der oder
die auch nicht einfach ignoriert, wenn ein wichtiger Datenpunkt aufkommt.