Im Gespräch mit
Prof. Dr. Peter-André Alt
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz


sagt Prof. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz im Gespräch mit Volker Stollorz, Geschäftsführer des Science Media Center Germany.
Veröffentlicht am 26. November 2021

Prof. Dr. Peter-André Alt ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und seit 2018 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Er hat viel beachtete Biografien etwa über Kafka oder Freud veröffentlicht, Monografien unter anderem über die Aufklärung, jüngst zur Exzellenz deutscher Universitäten.
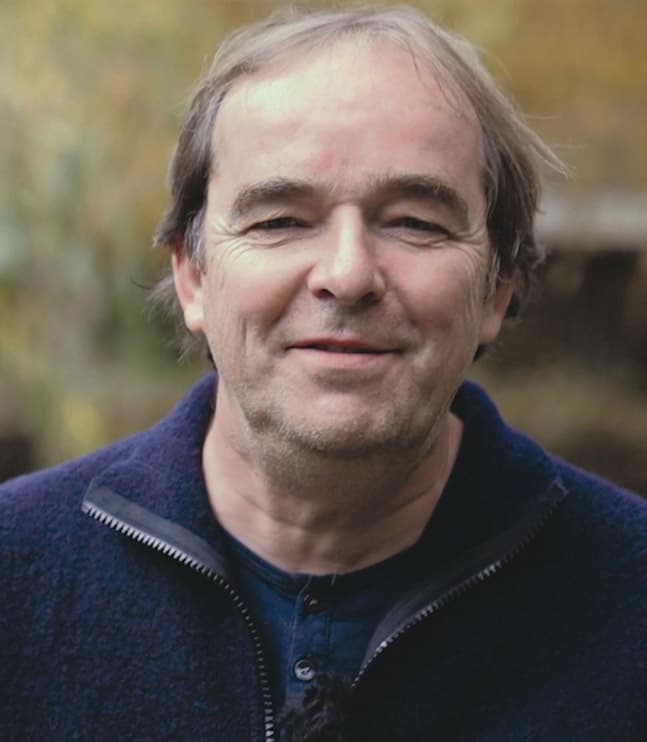
Volker Stollorz
ist Geschäftsführer des 2015 gegründeten Science Media Center Germany (SMC).
Seit 1991 berichtete der Wissenschaftsjournalist aus Leidenschaft über die
Reibungszonen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Volker Stollorz: Professor Alt, es ist schön, dass Sie bei Together for Fact News mitmachen. Das Motto unseres Science Media Center lautet: »Wir lieben Aufklärung«. Sie haben über die Aufklärung ein Lehrbuch geschrieben. Lohnt das eigentlich noch mit dem Vernunftgebrauch im Sinne der Aufklärung heutzutage, angesichts all der Krisen, die über uns hereinprasseln?
Peter-André Alt: Mehr denn je. Die Zeiten, in denen wir uns darüber unterhalten haben, dass die Aufklärung dialektisch ist und in den Mythos, in Verblendung umschlagen kann, sind fast schon wieder vorbei. Das war natürlich eine wichtige intellektuelle Erkenntnis der Frankfurter Kritischen Schule. Heute aber brauchen wir mehr denn je die Vernunft und auch die Aufklärung, da beide Begriffe uns bestimmte Regeln für Auseinandersetzungen an die Hand geben. Wir brauchen eine vernunftgeleitete, wissenschaftliche Diskussion, aber auch eine vernunftgeleitete Kommunikation über Wissenschaft. Aufklärung ist an der Zeit.
Dieses Motto war im SMC anfangs umstritten. Denn wie kann man Aufklärung »lieben«?
Leidenschaft spielt auch im Zentrum der Aufklärung eine ganz wichtige Rolle. Einer der großen deutschen Aufklärer mit europäischem Zuschnitt, Lessing, war ein sehr leidenschaftlicher Denker und ich finde die Formel, die sie als SMC da geprägt haben, sehr sympathisch. Ich finde: Wir brauchen die Vernunft, aber wir brauchen eben auch eine Vernunft, die engagiert und nicht einfach nur technokratisch und nüchtern zu Werke geht. Diese Synthese muss man anstreben.
Als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz sind Sie in gewisser Weise der »Chef« aller Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Was leisten Universitäten, was andere Institutionen nicht können? Was macht sie einzigartig?
Das, was Hochschulen besonders gut können, ist, eine Vielfalt von wissenschaftlichen Gebieten zu einem idealerweise produktiven Dialog, zu einem Miteinander in der gemeinschaftlichen Lösung großer Probleme zusammenzuführen. Diese Vielfalt der Fächer, zu der auch die Vielfalt der in der Institution tätigen Menschen bzw. Biografien gehört, ist einzigartig. Das, was aus der Vielfalt erwächst, muss die Hochschule aber auch immer wieder neu nutzen bzw. zu nutzen verstehen.
Sie haben vor Kurzem das Buch geschrieben »Exzellent!? Zur Lage der deutschen Universität«. Darin taucht ein Konzept aus dem Jahr 1963 auf. Clark Kerr hat damals den Begriff der »Multiversität« geprägt im Unterschied zu Universität. Was ist das Spezifische dieser Herausforderung?
Ich fand bemerkenswert, dass man von dem Konzept so lange nichts gehört hatte. Die Rede, die Clark Kerr in Harvard gehalten hat, stammt aus dem Jahr 1963. Der Einzige, der das in Deutschland aufgegriffen hat, war Ralf Dahrendorf zwei Jahre später in einem Buch zur Reform der deutschen Bildungslandschaft. Der Begriff ist relativ einfach zu beschreiben: Die Universitäten sind nicht nur groß, sondern auch vielfältig. Diese Vielfalt ist eine Herausforderung, aber zugleich ihre Chance. Herausforderung deshalb, weil in der Vielfalt immer auch die Vielstimmigkeit, die Dissonanz, der Konflikt, das Gegeneinander stecken. Die Chance liegt darin, dass solche Vielfalt eine enorme Kreativität freisetzt, weil einzelne Spezialinteressen und Forschungsfragen in einer fachspezifischen Konzentration durch ganz andere Perspektiven ergänzt werden. Das hat die Universität über Jahrzehnte gar nicht richtig genutzt und wahrgenommen. Da hat sie sich eher im Gegeneinander, in einem politischen Streitmodus befunden. Ich denke, dass sich das aber mittlerweile dadurch, dass auch wissenschaftliches Arbeiten viel mehr in der TeamplayPerspektive stattfindet, geändert hat.
Nun ist diese Vielfalt der akademischen Stimmen zumindest dann, wenn sie im öffentlichen Raum verhandelt wird, durchaus irritierend. Was macht die Universität im 21. Jahrhundert zu einer multiversitären Organisation?
Ihre Frage stellt ja ab auf das Phänomen des Wachstums der Aufgaben, das wir in den vergangenen 50, 60 Jahren beschleunigt beobachtet haben. Nicht nur, dass die Hochschulen immer größer werden, weil die Zahl der Studierenden und auch – leider nicht im gleichen Maße – der Lehrkräfte wächst. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Aufgabenvielfalt zunimmt. Das ist angemessen mit Blick auf die Komplexität unserer Problemlagen im 21. Jahrhundert. Zudem führen viele Wege von der Wissenschaft, eben nicht nur in die Erkenntnis, sondern auch in die Anwendung, die Patentierung von neuen Entdeckungen, in soziale Missionen und vieles mehr, was auch zu tun hat mit Kommunikation und Kommunikationserwartungen.
Genau! Die Wissenschaft muss sich selbst der Gesellschaft gegenüber erklären ...
Das sind ganz neue Anforderungen, die es vor 50 Jahren in dem Maße nicht gab. Es ist einerseits eine Chance, andererseits aber auch wieder ein Risiko. Die Chance besteht darin, dass die Hochschulen viel stärker, als das früher der Fall war, ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft finden. Das ist unbedingt zu unterstützen. Die Risiken bestehen darin, dass so etwas wie der zentrale Kern nicht mehr so sichtbar wird und dass eine Überlagerung von Aufgabenkomplexen stattfindet. Erstes Problem: Es gibt nicht genug Geld, alles gleichzeitig zu machen. Zweitens: Die Gefahr besteht, dass die Universitäten sich angleichen, dass sie ihre Profilschärfe verlieren, weil alle alles machen wollen und das nicht können. Das Risiko wächst, dass sie sich überfordern. Deswegen muss man eine gute Balance finden. Man muss die Universitäten in ihrer Vielfalt sichern, man darf nicht einfach irgendwelche Fächer wegstreichen. Andererseits muss man allen die Chance geben, auch einen eigenen Weg in dieser Vielfalt der Aufgaben zu finden und gelegentlich den Mut haben, zu sagen: Das verfolgen wir jetzt nicht prioritär, obwohl es im gesellschaftlichen Interesse liegt.
Auch Clark Kerr fragte sich, welche Kompetenzen ein Präsident, ein Rektor haben sollte. Er müsse ein Vermittler sein, so Kerr, er sollte den Frieden wahren. Dinge, die nicht gefährdet werden dürften, seien: Freiheit und Gleichheit. Da müsse der Vermittler zum Gladiator werden. Die zweite Aufgabe des Präsidenten sei es, darauf wollte ich hinaus, den Fortschritt zu fördern. Doch im Gegensatz zu den Giganten der Vergangenheit sei der neue Präsident kein Innovator, er sollte aber für fruchtbare Innovationen sensibel sein. Die meisten säßen im Kontrollturm und würden den wirklichen Piloten, also den Forschenden helfen, ohne Crash zu landen. Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis?
Das ist eine großartige Rede und die Metaphern sind viel anschaulicher als diese ganzen langweiligen Euphemismen vom Ermöglichen oder Begleiten, die man nicht mehr hören kann. Natürlich sollen Universitätsleitungen ermöglichen, dass gute Forschung stattfindet, und sie sollen gute Forschung begleiten, indem sie bestmögliche Bedingungen für sie schaffen. Das ist alles völlig klar und richtig, aber man muss daraus ein bisschen mehr machen. Ja, ich finde eigentlich diesen Kontrollturm als Bild gar nicht schlecht, denn tatsächlich möchte man ja sichere Flüge ermöglichen und zugleich allen die Chance geben, gut zu landen.
Manchmal müssen Fluglotsen aber auch sagen: keine Landeerlaubnis!
Da kommt dann die Metapher wiederum an ihre Grenzen. Man muss das, was riskant ist, nicht gleich abwürgen, aber man sollte es vielleicht nicht gleich auf den Langstreckenflug schicken, sondern zunächst kleine Testflüge durchführen.

Über Fortschritt und Innovation gibt es ganz interessante Untersuchungen im Wissenschaftsbarometer, also zum Vertrauen der Öffentlichkeit in Wissenschaft. Es seien drei Kriterien, die der Laie an Wissenschaft anlegt, so der Bildungsforscher Rainer Bromme. Ein Forscher soll kompetent sein, weiter soll er integer sein. Und drittens: Er soll dem Gemeinwohl dienen. Wenn ich jetzt als Universität sehr stark in Richtung Innovation, Fortschritt, Zusammenarbeit, Transfer, Patente gehe, dann werde ich schnell mit der Frage konfrontiert, wie es mit der Integrität und der Gemeinwohlorientierung aussieht, wenn ich Innovationen wirtschaftlich für den Standort Deutschland nutzbar machen soll. Ist das ein Problem?
Ja, das ist ein Spannungsverhältnis. Es ist so, dass man in der reinen Grundlagenforschung zunächst einmal die Regularien sehr viel einfacher einhalten kann, weil man diese Grenze, die sie gerade sehr gut beschrieben haben, noch nicht überschreitet. In dem Augenblick, in dem man sie überschreitet, kommt man tatsächlich in heiklere Gemengelagen, wenn etwa bestimmte Konzerne die Verwertung übernehmen, die gleichzeitig auch Geschäfte in Bereichen machen, die ethisch nicht in Ordnung und anrüchig sind. Man kann aber auch in Gemengelagen geraten, in denen potenziell die Anwendung zum Beispiel für militärische Zwecke oder für umweltschädliche Technologien möglich ist. Das Wichtigste ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst die verschiedenen Optionen, die sie schaffen, durch das Wissen, das sie bereitstellen, kritisch reflektieren. Daher habe ich vor einiger Zeit dafür plädiert, dass wir schon bei unseren Doktorandinnen und Doktoranden in die Qualifizierung auch die Wissenschaftsgeschichte ihres Fachs verstärkt integrieren. Und zwar ganz besonders die Geschichte der Zeiten, in denen man Wissenschaft ideologischen Zwecken untergeordnet hat, zum Beispiel im Dritten Reich. Sicherlich wird man nicht in jedem Fach die gesamte Wissenschaftsgeschichte vermitteln können, aber mir würde es schon reichen, wenn man einer Physikerin, einem Biologen, sagt: Schau dir mal an, was zwischen 1933 und 1945 in deinem Fach geschehen ist und wir zeigen jetzt ein paar Beispiele für Projekte, die wir heute zu Recht als unethisch empfinden und beurteilen und dann überlege mal: Kannst du in irgendeiner Weise einen Transferprozess vollziehen zu dem, was du gerade tust, gibt es da auch Risiken? Ich glaube, das ist das Wichtigste: Reflexionsfähigkeit zu fördern und zugleich Anwendungssensibilisierung im Blick auf die verschiedenen Optionen, die darin stecken.
Viele der Spitzenforscher, die wir im Science Media Center interviewen, arbeiten in diesen Grenzbereichen. Sie müssen sich mit Ethikern und Technologiefolgenabschätzern auseinandersetzen über Fragen, die ihrer Meinung nach in der Praxis manchmal noch gar keine Rolle spielen. Auch als Journalist sehe ich rote Linien, die nicht überschritten werden sollten. Stichwort China, das ja ganz strategisch in bestimmte Forschungsbereiche investiert etwa in Forschung an nichtmenschlichen Primaten zum Beispiel, wo wir in Europa ethische Bedenken hegen. China will sich dort Wettbewerbsvorteile verschaffen, etwa im KI Bereich. Wie gehen Sie mit diesem schwierigen Feld als Hochschulleitung um?
Forschung ist ein unglaublich komplexer Prozess. Er ist extrem zeitaufwendig und fordernd, auch für diejenigen, die die Expertise haben, sei es in experimentellen oder in einer geisteswissenschaftlichen Arbeitsebene. Und diese Konzentrationsleistung macht es nicht so selbstverständlich, dass man auch auf die Konsequenzen schaut. Insofern kann es eine gewisse Tendenz zur Naivität geben, die sich aus dieser ganz starken Konzentration auf ein Forschungsinteresse ableitet. Ich glaube, das Wichtigste ist, in den Fächern auch Routinen zu durchbrechen. Das meine ich mit Reflexionsleistung. Ich erwarte die Reflexionsleistung, auch wegzugehen von dem Mainstream, den man gerade in der fachlichen Richtung verfolgt, und zu überlegen, welche Risiken drohen könnten.
Nennen Sie ein Beispiel.
Ich nehme das Beispiel Tierversuche. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir auf dem richtigen Wege sind, wenn wir sehr genau analysieren, was wir ersetzen können, etwa durch Digitalisierung. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen sind Tierversuche noch nicht ersetzbar. Aber ich erwarte von all denjenigen, die in diesem Bereich arbeiten, dass sie das immer wieder kritisch hinterfragen. Ich habe bei der Besichtigung von Labors mit tierexperimentellen Forschungen zuweilen eine fast professionelle Verblendung wahrgenommen, eine Haltung, die das eigene Tun nicht kritisch hinterfragt. Das aber ist für jede Forschung wichtig, selbstverständlich auch für die Geisteswissenschaften.
Das eine ist, den Fortschritt organisieren, Risiken eingehen, vielleicht auch rote Linien überschreiten oder besser doch nicht im reflektierten Prozess. Der zweite relevante Bereich ist, was ich im weitesten Sinne als Journalist FringeForschung nenne. Das ist mediokere Forschung, bei der man nicht weiß, gehört das noch zur legitimen Forschung. Homöopathie wäre ein Stichwort. Sie haben ja ein wichtiges Buch über Siegmund Freud geschrieben. Ist Psychoanalyse eigentlich eine Wissenschaft im forschenden Sinne?
Auch wenn man sich lange damit beschäftigt hat, kommt man nicht so einfach auf einen klaren Punkt. Denn in der frühen Psychoanalyse, also den Studien zur Hysterie, steckt neben ganz praktischer Empirie, die sich ableitete aus Beobachtungen an Patientinnen und Patienten, auch sehr viel Spekulation. Das ist etwas, was die Lehre Freuds immer wieder durchzogen hat. Freud war einerseits geschult durch die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, aber andererseits auch ein extrem spekulativer Geist, der immer wieder Grenzen überschritten hat. Das erklärt das Unbehagen, das viele strenge Naturwissenschaften und viele heutige Ärzte mit seinen Lehren haben. Aber aus solchen Synthesen erwachsen auch sehr produktive Möglichkeiten. Und das macht die Psychoanalyse meiner Meinung nach immer noch attraktiv. Ich bedaure es, dass sie aus dem ganzen Forschungsspektrum der aktuellen Psychologie völlig verschwunden ist. Wenn sie heute Psychologie studieren, gleichgültig wo auf der Welt, dann werden sie nicht mehr mit den Arbeiten Freuds konfrontiert. Es gibt Bibliotheken psychologischer Institute, in denen steht noch nicht einmal die Gesamtausgabe. Das finde ich sehr bedauerlich.
PrePrints sind für die Kommunikation innerwissenschaftlicher Fortschritte begrüßenswert. Aber mit Blick auf die Kommunikation mit nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeiten, vor allem in digitalen Räumen, entstehen natürlich Risiken, die in der Wissenschaft noch nicht so richtig reflektiert werden. Wenn irgendwo auf der Welt jemand noch nicht ausgereifte, in irgendwelchen SpezialCommunitys hoch umstrittenes Wissen im Prinzip rezipieren und dann selbst in die Irre laufen kann, dann haben wir, glaube ich, als Gesellschaft darauf noch gar keine richtige Antwort und auch die Wissenschaft nicht.
Ja, haben wir noch nicht. Es gibt bekannte Beispiele. Eins war im vergangenen Jahr die DrostenStudie über die CoronaInfektion bei Kindern, deren öffentliche Diskussion auch einiges erklärt hat. Das Wichtige ist, dass wir immer wieder in der Wissenschaftskommunikation auf diese Vorstufen von Erkenntnis verweisen müssen und auch darauf, dass es da kein Schwarz und Weiß gibt, sondern sich um einen skalierten Prozess handelt. Es ist ja nicht so, dass wir diese wissenschaftliche Erkenntnis in einem Sprung erlangen, sondern in einem langwierigen Verfahren. Das kann langwierig sein, da gibt es kleinere und größere Fortschrittsbewegungen, aber auch immer wieder Rückschläge. Das ist etwas, was die Wissenschaftskommunikation vermitteln muss. Ich nenne das immer die wissenschaftliche Haltung und ihre Dynamik. Menschen neigen dazu, die Wissenschaft irrtümlich als Ersatzreligion zu sehen, die eine einzige unteilbare, dauerhaft gültige Wahrheit hervorbringt. Diese Funktion kann und soll Wissenschaft nicht erfüllen. Aber umgekehrt ist es auch problematisch, wenn der Eindruck entsteht, Wissenschaft produziere dauernd Halbgares, was noch nicht richtig durchdacht worden ist.
Genau das ist die Frage: Wie kann ich den Kernbereich einerseits schützen und gleichzeitig Fehlgebrauch verhindern? In Ihrem ExzellenzBuch erwähnen Sie Rudi Dutschke, einen der Protagonisten der Studentenbewegung. Der hatte in einem Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger, das im August 1968 im Kursbuch erschien, als Zielsetzung ausgegeben: Die Gesellschaft müsse eine große Universität werden, also mitten in den studentenbewegten Zeiten. Dutschke forderte eine Enthierarchisierung der Universitäten und die breitenwirksame Übersetzung ihrer Diskurskultur in der Gesellschaft. Der Soziologe Rudolf Stichweh verlangt sogar eine Professionalisierung von jedermann in der Wissensgesellschaft. Und auch die Bildungs- und Forschungministerin Anja Karliczek will Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler. Sind das nicht völlig unrealistische Erwartungen an Wissenschaftskommunikation?
Für die Studentenbewegung und ihren Exponenten Dutschke war damals die Universität eine Art Diskurslabor, das daran arbeitete, Hierarchien abzubauen. Dem stand eine Gesellschaft mit extremen Hierarchien, sehr wenig Diskursivität und starker Autoritätsfixierung gegenüber. Die Idee, die Universität zu einem Sozialmodell zu machen, war getrieben von dem Anspruch, die Gesellschaft im Sinne der Regeln des Diskurses der Universität zu verändern. Das hieß nicht, dass man die Menschen zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwandeln wollte, was heute in der bürgerwissenschaftlichen Diskussion viel eher eine Rolle spielt. Ich glaube, dass dieses Ziel wichtig ist, man aber auch die Grenzen bürgerlicher Beteiligung sehen und anerkennen muss. Jemand, der sich seit einem Jahr mit Virologie beschäftigt, kann einfach nicht den Einblick haben, den jemand hat, der das 30 Jahre ausschließlich und auf höchstem Forschungsniveau betreibt. Diese Limitierung muss man immer wieder – ohne dass man Frustration damit sät – deutlich machen. Man muss auch zeigen: dass Wissenschaft immer wieder mit sehr langwierigen, zeitintensiven Arbeitsprozessen verbunden ist. Das heißt nicht, dass jemand, der aus dem System kommt, alles allein lösen kann. Es kann auch hilfreich sein, einen externen Blick zu pflegen. Das ist letzten Endes doch das Prinzip, das Humboldt schon implementiert hat: Wer über seine Forschung spricht und auch Studierenden vermittelt, lernt dadurch etwas über genau diese Forschung.
Kommen wir zum Bereich Öffentlichkeit und zum Journalismus über Wissenschaft. Der Wissenschaftsjournalismus als Profession wird derzeit attackiert nach dem Motto: Ihr habt viel zu wenig Vielfalt, viel zu wenig Dissens abgebildet, ihr habt nicht genug Experten gefragt, die auch noch was sagen wollten. Ich finde diese Kritik albern. Aber wie schauen Sie auf den Wissenschaftsjournalismus und seine Leistungen?
Man hat da zwei Möglichkeiten, das zu beurteilen. Das eine wäre: Der Wissenschaftsjournalismus muss ungefähr in Mengen das abbilden, was sich verteilt an Positionen in der Wissenschaft. Das tut er faktisch gar nicht, sondern er gibt den Minderheiten sehr, sehr viel mehr Raum, als eigentlich rein statistisch notwendig wäre. Man kann sehr gut nachweisen, dass die Behauptung, die abweichenden Meinungen kämen nicht genügend zur Geltung, fast immer vollkommen falsch ist. Tatsächlich ist es so, dass die abweichenden Meinungen im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich in der quantitativen Verteilung im Wissenschaftssystem repräsentieren, überproportional im wissenschaftsjournalistischen Diskurs vertreten sind. Trotzdem haben diejenigen, die auf dieser Seite stehen, immer das Gefühl, dass sie zu kurz kommen. Zugleich ist es aber bedeutsam, dass anders als früher auch der Wissenschaftsjournalismus selbst zum Gegenstand öffentlicher Debatten wird. Wir haben hier eine ganz interessante Entwicklung durchlaufen und das halte ich an sich nicht für problematisch. Wir müssen nur aufpassen, dass die Erwartungen nicht in die falsche Richtung gehen. Jeder Wissenschaftsjournalist, jede Wissenschaftsjournalistin muss in der Darstellung von Themen komprimieren und auch verkürzen. Das birgt natürlich enorme Risiken, das ist ganz klar. Aber ich finde sehr beachtlich, was in den vergangenen anderthalb Jahren mit Blick auf die Pandemie im Bereich des Wissenschaftsjournalismus geleistet worden ist, und würde sagen, auch die Verteilung ist in Ordnung.
Einen Bereich lassen Wissenschaftsjournalisten selbst gern links liegen und das ist interessanterweise die Forschungspolitik. Es gibt zwar einige profilierte, aber zu wenige. Das übernehmen Bildungsjournalisten oder Berichterstatter über das Hochschulwesen. Deswegen die Frage an Sie als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz: Welchen Wissenschaftsjournalismus der Zukunft wünschen Sie sich, welchen brauchen wir unabhängig von Finanzen und Krise und Digitalisierung?
Ich stimme zunächst dem Befund sehr zu. Eigentlich sind es nur drei Tageszeitungen, die sich überhaupt mit Wissenschaftspolitik im engeren Sinne beschäftigen und selbst unter den größeren berichten viele überhaupt nichts zum Thema. Das liegt natürlich daran, dass das ein bisschen den Geruch der Metaebene hat. Wissenschaft ist schon ein sperriges Thema, aber Wissenschaftspolitik, wo es „nur“ darum geht, was man wie am besten fördert und wo mehr Geld hineinfließen soll, ist dann schon wieder so speziell, dass auch die Chefredaktion sagt, bitte lasst uns damit in Ruhe. Das ist falsch. Vor allen jetzt merkt man das wieder. Im Wahlkampf hatten wir zu wenig wissenschaftspolitische Themen auf der Agenda. In keinem Triell ist eine einzige forschungspolitische Frage gestellt worden. Und wenn wir in der Diskussion über die Entwicklung in den vergangenen anderthalb Jahren konstatieren, dass die Hochschulen nicht vorgekommen, die Lage der Studierenden nicht besprochen wurde, spiegelt das in gewisser Weise, wie nachrangig die Wissenschaftspolitik behandelt wird. Das muss anders werden und da müssten uns auch die Medien unterstützen.
Angenommen, der Journalismus würde morgen verschwinden, sich einfach auflösen, weil er kein Publikum mehr hat, was ist dann mit der Wissenschaft? Ich glaube, dass wenn die Wissenschaft ohne guten Journalismus gegen jene steht, die ganz laut Interessenpolitik, Desinformation im Internet und in den digitalen Medien betreiben können, ganz schlechte Karten hat, weil sie komplexe Sachverhalte vertritt. Wie sehen Sie das?
Natürlich ist das nicht von der Wissenschaft allein zu leisten. Ich finde es richtig, dass wir unsere neu berufenen Professorinnen und Professoren auch für die Notwendigkeit von Kommunikation sensibilisieren und sie möglichst schon in frühen Karrierephasen dafür qualifizieren. Aber wir brauchen einen professionellen Wissenschaftsjournalismus, der diese Themen dann wirklich in einer anderen Weise noch einmal aufbereitet und transportiert. Und dafür benötigen wir auch eine Vielfalt von Kompetenzen. Bislang kommen im Wissenschaftsjournalismus die meisten aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Wir brauchen insofern dringend mehr naturwissenschaftlich qualifizierte Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten.
Sehen Sie eigentlich die Hochschulen gut vorbereitet auf das, was im Moment als eine Politisierung der Wissenschaften sichtbar wird, dass wieder mehr Diskurs, mehr Debatte auf dem Campus stattfindet. Kerr ist damals sogar abgesetzt worden in diesen ganzen Tumulten der „Free Speech Movement“ in den 1960er Jahren. Ich habe so das Gefühl, dass in den Universitäten im Moment sehr, sehr viel los ist, sehr viel Politisierung auch, Stigmatisierung teilweise, Diskussionen über Kolonialismus, Gender, Zivilklauseln. Wie sind die Hochschulen darauf vorbereitet?
Sie sind nicht wirklich darauf vorbereitet. Sie lernen aus Krisen und Konflikten, das tun sie auch schnell. Aber sie haben sich über viele Jahrzehnte in einem Modus befunden, in dem zwar Streitverhältnisse in Außenbeziehungen entstanden, etwa gegenüber der finanzierenden Politik und auch gegenüber Erwartungen der Förderpolitik. Da ging es um Fragen der Mission oder der Anwendungsorientierung von Forschung. Die Hochschulen selbst aber waren intern eigentlich relativ befriedete Räume. Jetzt kommen wir wieder in eine Phase, in der wir mit Streit rechnen müssen, weil es nämlich um ganz grundsätzliche Dinge geht, die nicht mehr zusammenpassen: Wie weit müssen Minderheiten zum Indikator für Themenakzeptanz gemacht werden? Inwiefern ist Respekt, inwiefern ist aber auch eine fundamentalistische Orientierung an bestimmten Werten ausschlaggebend für die Wahl von Themen? Gilt das alte, wie ich finde, richtige liberale Muster, dass Hochschulen Orte sein müssen, an denen über alle Themen gesprochen werden darf und an denen auch Menschen unterschiedlicher Meinungen reden dürfen? Diese Grundspannung ist in den USA sehr viel schärfer, aber sie wächst auch in Deutschland. Wenn die Hochschulen sich nicht darauf verständigen, welche Grundprinzipien sie für schützenswert halten und wenn sie zugleich nicht auch Techniken entwickeln, wie sie mit Konflikten umgehen, wird es schwierig. Ich denke, das müssen sie in den nächsten Jahren tun.
Wenn man wissenschaftshistorisch auf die 1960erJahre schaut, ging es ja ganz schön heftig zu. Dafür ist es eigentlich noch kommod im Moment.
Es ging viel heftiger zu, es ging ja bis zu persönlichen, auch körperlichen Attacken, zu Sachbeschädigungen, es sind Professoren mit dem Stuhl aus dem Fenster geworfen worden. Das waren Zeiten, in denen wirklich rabiat und rücksichtslos von verschiedenen Gruppen vorgegangen wurde. Wobei dieses Rabiate auf beiden Seiten da war. Es gab auch bei den Professorinnen und Professoren aggressive Tendenzen, ideologische Stigmatisierungen und Ausgrenzungen. Das war eine Zeit der zerstörten Diskurskultur. Demgegenüber ist das jetzt eher harmlos. Dennoch ist es so, dass wir keinen Konsens mehr über bestimmte Grundsatzfragen haben. Das alte liberale Paradigma, das erlaubt, über alles zu sprechen, wenn die Regeln des Diskurses eingehalten werden und nicht strafgesetzliche Tatbestände betroffen sind, ist in Frage gestellt und muss verteidigt werden.
Das ist das, was Kerr mit der Verteidigung der Freiheit, der Forschung und Lehre ja am Ende auch meinte. Das wird doch aber schwieriger?
Ja, das wird schwieriger. Im Namen bestimmter, fundamentalistischer Wertvorstellungen heißt es immer häufiger: Darüber wollen wir nicht reden, das empfinden wir als respektlos, dieses Thema darf nicht sein oder diese Person empfinden wir als so störend und als so problematisch, dass wir sie auf dem Campus nicht sehen wollen. Das kann man im Persönlichen nachvollziehen. Ich würde niemals einem Menschen abstreiten, solche Argumente anzuführen. Ich würde niemals infrage stellen, dass es Menschen gibt, die sich durch bestimmte Meinungen in ihrem persönlichen Lebensentwurf gefährdet und auch bedroht fühlen. Ich glaube aber, so ernst das für das Individuum zu nehmen ist, so wenig kann das zur Grundlage für grundsätzliche Entscheidungen über Meinungsfreiheit herangezogen werden, da der hohe Wert der Meinungsfreiheit auch für die Ebene der Hochschulen gilt. Natürlich gibt es Regeln. Ich finde es nicht richtig, wenn Parteiwahlkämpfe von den Campi ausschließen. Aber wenn Politikerinnen und Politiker an Hochschulen reden, sollte das willkommen sein. Die müssen sich dann den Regeln des wissenschaftlichen Diskurses stellen. Sie müssen auch ihre Themen so setzen, dass sie an Debatten in Seminaren oder Vorlesungen abschließen. Sie müssen transparent, fair und nicht demagogisch argumentieren. Das sind die einfachsten Rahmenbedingungen. Wenn diese Regeln eingehalten sind, dann bin ich der Meinung, dass die Vielfalt der Themen dringend geboten und zu schützen ist.
Was heißt »Together for Fact News« ganz konkret für Sie?
Ich bin, was den Faktenbegriff angeht, als Geisteswissenschaftler ein bisschen skeptisch. Als wir vor einigen Jahren den großartigen »March for Science« hatten, war ich in Berlin mit dabei und durfte da auch sprechen. Es wurden viele Transparente getragen. Auf einem hieß es »Only Facts Matter«. Das ist in gewisser Weise richtig, aber wir wissen eben auch aus der Erkenntnistheorie, dass Fakten nichts sind, was ontologisch, also in den seienden Verhältnissen unserer Welt schon vorgegeben ist und was wir nur aufsammeln müssen. Einer meiner akademischen Lehrer sagte einmal: Wenn es reichen würde, die Dinge einfach nur aufzuessen oder gegen sie zu treten, dann bräuchten wir keine Sprache. Das heißt, dass Fakten hergestellte Konstruktionen sind und dass es nicht unbedingt nur eine einheitliche Perspektive gibt. Diese etwas kritische Perspektive auf Fakten wäre mir wichtig.
Stiftung Brandenburger Tor, Max Liebermann Haus, Berlin
Deswegen heißt die Initiative ja auch »Together for Fact News«, also Nachrichten, die richtige und wichtige Nachrichten faktenbasiert in die Welt bringen, wofür es guten Journalismus braucht und gute Wissenschaft ...
Ich finde die Kampagne richtig, weil natürlich Facts anstelle von Fake einfach die angemessene Opposition ist. Aber wir müssen eben auch neben die Fakten die Faktenreflexion stellen. Wenn die wissenschaftliche Ebene für die Wissenschaftsberichterstattung wirklich leitend sein soll, muss das einschließen, dass ein Bewusstsein darüber vermittelt wird, dass Empirie hinterfragt werden kann, dass jede quantitative Untersuchung an bestimmte Grenzen stößt und dass Wissenschaft immer auch ein Reflexionswissen über das einschließen muss, was man gerade an Fakten produziert.
Ich habe neben Biologie Philosophie studiert, um als Wissenschaftsjournalist dieses Reflexionswissen in den Journalismus über Wissenschaft zu tragen. Das ist ein Nachhall jenes C.P. SnowBuchs, also den zwei Kulturen zwischen, sagen wir, einerseits den Physikern, die meinen, die Planetenbewegung ist erklärt und andererseits denen, die sagen, jedes Faktum, jede Tatsache, jedes Naturgesetz muss auch wieder hinterfragt werden – all das ist am Ende auch nur eine soziale Konstruktion in der Sprache.
Das ist so, ich bemerke das auch, wenn ich mit Vertreter:innen anderer Fachkulturen rede. Vielleicht muss man es auch nicht so angehen, dass man die Naturwissenschaften meint überzeugen zu müssen, dass alle Fakten etwas sind, was man wieder hinterfragen kann. Vielleicht müssen wir nach der Analogie suchen: Wenn wir in den Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften sagen, wir müssen Fakten reflektieren – welche Haltung entspricht dem eigentlich in den Naturwissenschaften? Ich glaube, dass es die Haltung ist, mit der man auch experimentelle Ergebnisse hinterfragt. Wenn man so vorgeht, kommt man auf den Begriff, der die zwei Kulturen vielleicht versöhnt: Skeptizismus. Es geht darum, bei aller Begeisterung skeptisch zu sein und die eigenen Ergebnisse kritisch zu durchleuchten – und das tut jeder gute Naturwissenschaftler ja auch. Wir brauchen in der Wissenschaft also beides: Emotionen, weil sonst die Leidenschaft im Denken fehlt, und den Skeptizismus. Das schließt eine gewisse Reserve gegenüber Anwendungsenthusiasmus ein, also auch ein Reflektieren über Grenzen und Risiken der Anwendung ein.
Aber wir wissen natürlich auch aus der Erkenntnistheorie: Es gibt auch einen toxischen Skeptizismus, der alles zersetzt und am Ende nur sagt, im Zweifeln um des Zweifeln willen und deswegen tun wir auch nichts gegen den Klimawandel, denn es gibt noch Zweifel, die legitim sind.
Das hat viel mit Psychologie zu tun. Solche Mentalitäten gibt es. Sie treffen in jedem Team auch genau diese Haltungen. Sie treffen Enthusiasten, Problemlöser, Pragmatiker, die mit dem Kopf durch die Wand wollen, Prinzipienorientierte und sie finden auch Skeptiker, die im Grunde bei allem immer sagen, das geht doch nicht, oder das ist doch eigentlich noch mal zu durchleuchten. Ich meine mit dem Skeptizismus etwas anderes, nämlich dass man versucht, eine andere Perspektive einzunehmen. Zum kritischen Denken gehört immer auch, sich neben sich zu stellen und beim Denken zuzusehen. Das ist gut für die Wissenschaft.
www.zlb.de, Zentral und Landesbibliothek Berlin
Unsere Initiative ist eine Kampagne. Wir wollen eintreten dafür, dass Argumente der Wissenschaften im öffentlichen Raum eine größere Rolle spielen dürfen. Wieso machen Sie mit?
Weil ich finde, dass Wissenschaft im 21. Jahrhundert in der Mitte der Gesellschaft steht und in alle Richtungen ausstrahlt – im Guten wie im Schlechten. Wir müssen uns aus der Wissenschaft an den großen Diskussionen beteiligen, Sachverhalte erläutern, Fakten und deren kritische Einordnung in die Gesellschaft tragen, der Politik erklären. Deswegen müssen wir Wissenschaftskommunikation betreiben und das permanent. Der bekannte Satz: »Man kann nicht nicht kommunizieren« gilt für die Wissenschaftskommunikation genauso. Das schließt aber ein, dass man sie auf einem qualitativ hohen Niveau betreiben muss. Dafür möchte ich mich weiter auch als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz engagiert einsetzen.
PDF zum Download (2,4 MB)